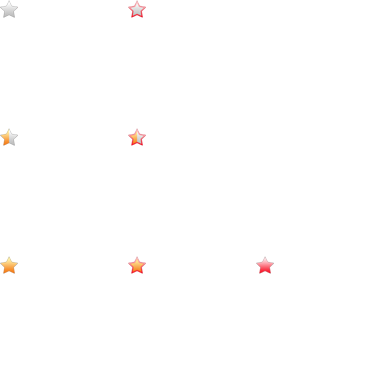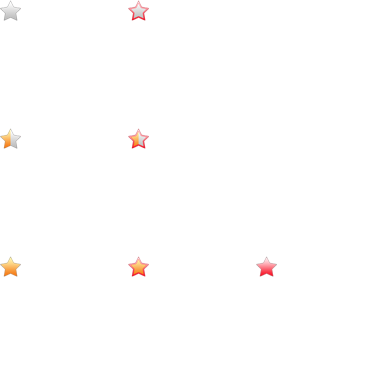Hier beginnt die eigentliche Meldung:
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 15.05.2014
- Vf. 8-VII-12, Vf. 24-VII-12 -
Pflicht zur Zahlung des Rundfunkbeitrags im privaten Bereich und nicht privaten Bereich verfassungsgemäß
Erhebung des Rundfunkbeitrags mit Bayerischer Verfassung vereinbar
Die Pflicht zur Zahlung eines Rundfunkbeitrags im privaten Bereich für jede Wohnung und im nicht privaten Bereich für Betriebsstätten sowie für Kraftfahrzeuge ist verfassungsgemäß. Dies entschied der Bayerische Verfassungsgerichtshof und wies mehrere Popularklagen gegen die Erhebung des neuen Rundfunkbeitrags zurück.
Gegenstand der zugrunde liegenden zwei Popularklageverfahren war die Frage, ob der Zustimmungsbeschluss des Bayerischen Landtags vom 17. Mai 2011 zu mehreren Bestimmungen des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags (RBStV) über die Erhebung von Rundfunkbeiträgen im privaten und im nicht privaten Bereich gegen die Bayerische Verfassung verstößt.
Kläger der Popularklage (Vf. 24-VII-12): Drogeriekette Rossmann
Kläger der Popularklage ( Vf. 24-VII-12) ist die Drogeriemarktkette Rossmann. Rossmann sieht sich hinsichtlich des neuen Rundfunkbeitrags in ihrem Gleichheitsgebot verletzt. Rossmann trug vor, wegen des neuen Rundfunkbeitrags deutlich höhere Kosten zu haben. Statt vorher ca. 40.000 Euro Rundfunkgebühr pro Jahr müsse Rossmann jetzt ca. 200.000 Euro
Kläger der Popularklage (Vf. 8-VII-12): Jurist Ermano Geuer
Der Kläger des Verfahrens Vf. 8-VII-12 ist der Passauer Jurist Ermano Geuer. Er ist der Ansicht, dass der neue
Hintergrund zur Erhebung des Rundfunkbeitrags
Bis zum Inkrafttreten der angegriffenen Bestimmungen wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch gerätebezogene Rundfunkgebühren finanziert. Vor dem Hintergrund der technischen Entwicklung und zunehmenden Verbreitung von multifunktionalen Geräten wurde dieses Finanzierungssystem umgestellt. Seit Januar 2013 werden geräteunabhängige, wohnungs- und betriebsstättenbezogene Rundfunkbeiträge erhoben. Im privaten Bereich ist für jede Wohnung ein
Antragsteller rügen Verstoß gegen allgemeine Handlungsfreiheit und gegen den Gleichheitssatz
Die Antragsteller machen geltend, der neue
Gewählte Typisierung für Vollzug einer einfachen und praktikablen Ausgestaltung der Abgabenpflicht nach Auffassung des Bayerische Landtags und der Bayerischen Staatsregierung sachgerecht
Der Bayerische Landtag und die Bayerische Staatsregierung halten die Popularklagen für unbegründet. Im neuen Beitragsmodell sei entscheidend, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk angeboten werde, dass also jederzeit die Möglichkeit bestehe, Rundfunkprogramme als allgemein zugängliche Quelle zu nutzen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass nach statistischen Erhebungen in Deutschland in 97 % aller Wohnungen mindestens ein Fernseher, in 96 % mindestens ein Radio und in 77 % mindestens ein internetfähiger Computer vorhanden seien. Für die Zulässigkeit der gewählten Typisierung spreche weiter, dass der Vollzug eine einfache und praktikable Ausgestaltung der Abgabenpflicht erfordere. In Unternehmen werde ebenfalls typischerweise Rundfunk empfangen. Die Staffelung des zu zahlenden Beitrags nach der Anzahl der Beschäftigten sei sachgerecht. Das Innehaben eines betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs sei ebenfalls tauglicher Anknüpfungstatbestand für eine Rundfunkbeitragspflicht. Die Abgabenpflichtigen hätten die Rundfunkabgabe zu zahlen, weil ihnen durch den Rundfunk eine allgemeine Informationsquelle erschlossen werde, also ein Vorteil zuwachse. Es handle sich daher nicht um eine in die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes fallende Steuer. Die Anzeigepflichten und Auskunftsrechte seien durch das Interesse an einer angemessenen Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerechtfertigt. Durch den Meldedatenabgleich werde der Entstehung von Vollzugsdefiziten entgegengewirkt.
Der Bayerische Rundfunk, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, das Zweite Deutsche Fernsehen und das Deutschlandradio halten die Popularklagen ebenfalls für unbegründet.
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof wies die Popularklagen ab. Die Entscheidung stützt sich auf folgende Grundsätze:
1. Die Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags über die Erhebung eines Rundfunkbeitrags im privaten Bereich für jede Wohnung (§ 2 Abs. 1 RBStV) und im nicht privaten Bereich für Betriebsstätten (§ 5 Abs. 1 RBStV) sowie für Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV) sind mit der Bayerischen Verfassung vereinbar.
2. Bei dem
3. Dem Charakter einer Vorzugslast steht nicht entgegen, dass auch die Inhaber von Raumeinheiten, in denen sich keine Rundfunkempfangsgeräte befinden, zahlungspflichtig sind. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zwingt den Gesetzgeber nicht dazu, eine Befreiungsmöglichkeit für Personen vorzusehen, die von der ihnen eröffneten Nutzungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen wollen.
4. Im privaten Bereich wird mit der Anbindung der Beitragspflicht an das Innehaben einer Wohnung (§ 3 Abs. 1 RBStV) die Möglichkeit der Rundfunknutzung als abzugeltender Vorteil sachgerecht erfasst.
5. Mit den näher bestimmten Merkmalen Betriebsstätte (§ 6 Abs. 1 und 3 RBStV), Beschäftigte (§ 6 Abs. 4 RBStV) und Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV), welche die Beitragspflicht im nicht privaten Bereich dem Grunde und der Höhe nach steuern, hält der Gesetzgeber sich im Rahmen seines Gestaltungsspielraums. Diese Kriterien sind hinreichend realitätsgerecht und ausreichend differenziert, um den beitragsauslösenden Vorteil abzubilden und die Beitragslasten im Verhältnis der Abgabenpflichtigen untereinander angemessen zu verteilen.
6. Die Anzeige- und Nachweispflichten, die § 8 i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 3 RBStV den Beitragsschuldnern auferlegt, sind
Zu der Entscheidung im Einzelnen:
Bayerischer VerfGH erklärt Rundfunkbeitrag für verfassungsgemäß
Die Pflicht zur Zahlung eines Rundfunkbeitrags im privaten Bereich für jede Wohnung (§ 2 Abs. 1 RBStV) und im nicht privaten Bereich für Betriebsstätten (§ 5 Abs. 1 RBStV) sowie für Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBStV) ist
Keine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips
Das Rechtsstaatsprinzip (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 BV) ist nicht wegen eines Widerspruchs zur Kompetenzordnung des Grundgesetzes verletzt. Der Freistaat Bayern hat mit der Zustimmung zu den angegriffenen Vorschriften des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags von seiner Gesetzgebungskompetenz aus Art. 70 Abs. 1 GG Gebrauch gemacht, ohne dabei die durch die Finanzverfassung des Grundgesetzes gezogenen Grenzen zu überschreiten.
Beitrag wird sowohl im privaten als auch im nicht privaten Bereich nicht „voraussetzungslos“ geschuldet
Bei der Zahlungsverpflichtung, die der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag den Inhabern von Wohnungen, Betriebsstätten und Kraftfahrzeugen zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auferlegt, handelt es sich um eine nichtsteuerliche Abgabe. Der Beitrag ist sowohl im privaten als auch im nicht privaten Bereich im Gegensatz zu einer Steuer nicht „voraussetzungslos“ geschuldet, sondern wird als Gegenleistung für das Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks erhoben. Die Zahlungsverpflichtung besteht unabhängig von der tatsächlichen Rundfunknutzung und knüpft an die bestehende Möglichkeit der Nutzung an, ohne dass, wie bei der früheren gerätebezogenen Rundfunkgebühr, die für einen Empfang erforderlichen Einrichtungen vorhanden sein müssen. Dazu stellen die Beitragstatbestände auf das Innehaben bestimmter Raumeinheiten und damit mittelbar auf die dort vermuteten Nutzungsmöglichkeiten für bestimmte Personengruppen ab. Stellt der
Erhebung des Rundfunkbeitrags ist sachlich gerechtfertigt
Der
Gesetzgeber hat zustehenden Gestaltungsspielraum bei der Abgabenbemessung nicht überschritten
Es ist nichts dafür ersichtlich, dass der Gesetzgeber bei der Abgabenbemessung den ihm zustehenden Gestaltungsspielraum überschritten haben könnte. Die Höhe des Rundfunkbeitrags von monatlich 17,98 Euro entspricht der Summe von monatlicher Grundgebühr (5,76 Euro) und Fernsehgebühr (12,22 Euro), die bis zum 31. Dezember 2012 erhoben wurden. Schon deshalb liegt die Annahme fern, der
Kein Verstoß gegen allgemeine Handlungsfreiheit
Die Zahlungspflichten im privaten und im nicht privaten Bereich sind verhältnismäßig und verstoßen daher nicht gegen die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 101 BV). Dies gilt auch für die Inhaber von Raumeinheiten, in denen sich keine Rundfunkempfangsgeräte befinden. Denn diesen bietet bereits das Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Vorteile, auf deren Abgeltung der
Rundfunkbeitrag im privaten Bereich nicht unangemessen hoch
Der
Finanzielle Belastungen für Betriebsstätten zumutbar
Im nicht privaten Bereich sind die Belastungen ebenfalls zumutbar. Für Betriebsstätten ist die Höhe des Rundfunkbeitrags gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 RBStV nach der Zahl der neben dem Inhaber in der Betriebsstätte Beschäftigten degressiv gestaffelt. Die gestaffelten Beitragssätze beginnen mit einem Drittel des Rundfunkbeitrags, also 5,99 € monatlich, für Betriebsstätten mit keinem oder bis acht Beschäftigten und reichen bis 180 Rundfunkbeiträge, das sind 3.236,40 € monatlich, für Betriebsstätten mit 20.000 oder mehr Beschäftigten. Daneben ist für jedes zugelassene Kraftfahrzeug ein Drittel des Rundfunkbeitrags zu entrichten, wobei gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 RBStV jeweils ein Kraftfahrzeug für jede beitragspflichtige Betriebsstätte beitragsfrei bleibt. Die daraus resultierende finanzielle Belastung ist mit Blick auf die einzelne Betriebsstätte oder das einzelne Kraftfahrzeug gering. Auch soweit sie sich bei großen Betrieben insbesondere wegen besonderer Strukturen mit zahlreichen Filialen erheblich vervielfachen kann, lässt sich ein grobes Missverhältnis zu den verfolgten Zwecken der Kostendeckung und des Vorteilsausgleichs nicht erkennen.
Keine Verletzung des Gleichheitssatzes
Der Gleichheitssatz (Art. 118 Abs. 1 BV) ist nicht verletzt. Indem der Gesetzgeber jedem Wohnungsinhaber (§ 2 Abs. 2 RBStV) ohne weitere Unterscheidung einen einheitlichen
Typisierung soll Beitragserhebung vereinfachen und Schutz der Privatsphäre verbessern
Anknüpfungspunkt für die Rundfunkbeitragspflicht ist die Möglichkeit der Programmnutzung, die im privaten Bereich typisierend den einzelnen Wohnungen und damit den dort regelmäßig in einem Haushalt zusammenlebenden Personen zugeordnet wird. Durch den Wohnungsbegriff (§ 3 RBStV) werden verschiedene Lebenssachverhalte – von dem allein lebenden „Medienverweigerer“ über die „typische“ Familie bis hin zur „medienaffinen“ Wohngemeinschaft – normativ zusammengefasst und einer einheitlichen Beitragspflicht unterworfen, die sämtliche Möglichkeiten der Rundfunknutzung einschließlich der mobilen und derjenigen in einem privaten Kraftfahrzeug abdeckt. In sachlich vertretbarer Weise soll im Vergleich zur früheren gerätebezogenen Rundfunkgebühr das Erhebungsverfahren deutlich vereinfacht und zugleich der Schutz der Privatsphäre verbessert werden, weil Ermittlungen „hinter der Wohnungstüre“ entfallen. Die Typisierung beugt zudem gleichheitswidrigen Erhebungsdefiziten oder Umgehungen und beitragsvermeidenden Gestaltungen vor. Sie verhindert damit eine Benachteiligung der Rechtstreuen und dient einer größeren Abgabengerechtigkeit.
Tatsächliche Bereitstellung eines Empfangsgeräts nicht mehr ausschlaggebend
Der Gleichheitssatz verlangt nicht, dass dem einzelnen Wohnungsinhaber zur Vermeidung der Beitragspflicht der Nachweis erlaubt wird, in dem durch seine Wohnung erfassten Haushalt werde das Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht empfangen. Insbesondere muss der Gesetzgeber nicht an der für die frühere Rundfunkgebühr maßgeblichen Unterscheidung festhalten, ob ein Empfangsgerät bereitgehalten wird oder nicht. Aufgrund der technischen Entwicklung elektronischer Medien im Zuge der Digitalisierung hat das Bereithalten eines Fernsehers oder Radios als Indiz für die Zuordnung eines Vorteils aus dem Rundfunkangebot spürbar an Überzeugungs- und Unterscheidungskraft eingebüßt. Rundfunkprogramme werden nicht mehr nur herkömmlich – terrestrisch, über Kabel oder Satellit – verbreitet, sondern auch in das Internet eingestellt. Neben herkömmliche monofunktionale Geräte zum Empfang von Hörfunk- oder Fernsehprogrammen tritt eine Vielzahl neuartiger multifunktionaler, teilweise leicht beweglicher Geräte, wie internetfähige stationäre oder mobile Personalcomputer, Mobiltelefone und Tabletcomputer. Die Verbreitung der herkömmlichen wie modernen Empfangsgeräte ist nahezu flächendeckend. Aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit und Mobilität ist es zudem nahezu ausgeschlossen, das Bereithalten solcher Geräte in einem Massenverfahren in praktikabler Weise und ohne unverhältnismäßigen Eingriff in die Privatsphäre verlässlich festzustellen.
Keine Unterscheidung zwischen Rundfunk- und Fernsehnutzung
Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und Medienkonvergenz ist es auch nicht zu beanstanden, dass für die Beitragsbemessung nicht mehr, wie bei der früheren Rundfunkgebühr, zwischen Hörfunk- und Fernsehnutzung unterschieden, sondern ein einheitlicher, das gesamte Programmangebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abdeckender Beitrag erhoben wird.
Typisierungsbefugnis des Gesetzgebers auch im unternehmerischen Bereich nicht überschritten
Der im nicht privaten Bereich abzugeltende Vorteil, der dem Unternehmer durch das Programmangebot des Rundfunks zuwächst, wird typisierend an die Raumeinheiten Betriebsstätte und Kraftfahrzeug geknüpft und damit den dort sich üblicherweise aufhaltenden, durch die gemeinsame Erwerbstätigkeit verbundenen Personen(gruppen) zugeordnet. Diese Kriterien sind auch unter Berücksichtigung der höchst unterschiedlichen Strukturen im unternehmerischen Bereich hinreichend realitätsgerecht und ausreichend differenziert, um den beitragsauslösenden Vorteil abzubilden und die Beitragslasten im Verhältnis der Abgabenpflichtigen untereinander angemessen zu verteilen. Der Gesetzgeber hat auch für den unternehmerischen Bereich seine weite Typisierungsbefugnis nicht dadurch überschritten, dass er die Beitragspflicht grundsätzlich unwiderleglich und insbesondere nicht gerätebezogen ausgestaltet hat.
Unterschiedliche Behandlung von privaten und nicht privaten Bereichen in Bezug auf Beitragspflicht für Kraftfahrzeuge gerechtfertigt
Dass Kraftfahrzeuge unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 RBStV bei der Bemessung des Beitrags im nicht privaten Bereich zu berücksichtigen sind, ist plausibel. Denn im Verhältnis zum sonstigen unternehmerischen Bereich kommt es in einem betrieblichen Kraftfahrzeug, ähnlich wie in einem Hotel- oder Gästezimmer (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 RBStV), nach der Lebenserfahrung zu einer deutlich gesteigerten Nutzung des (Hörfunk-)Programmangebots. Das darf der Gesetzgeber zum Anlass für eine eigenständige Vorteilsabgeltung nehmen, die mit einem Drittel des Rundfunkbeitrags für jedes beitragspflichtige Kraftfahrzeug sachgerecht bemessen ist. Eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung gegenüber dem privaten Bereich, in dem der wohnungsbezogene
Beitragsstaffelung für Betriebsstätten nach der Zahl der Beschäftigten nicht zu beanstanden
Die in § 5 Abs. 1 Satz 2 RBStV festgelegte degressive Beitragsstaffelung für Betriebsstätten nach der Zahl der neben dem Inhaber Beschäftigten in zehn Stufen ist sachgerecht und bedarf keiner weiteren Differenzierung. Der zu leistende Beitrag beträgt auf der ersten Stufe für Betriebsstätten mit keinem oder bis acht Beschäftigten ein Drittel des Rundfunkbeitrags, auf der zweiten Stufe für Betriebsstätten mit neun bis 19 Beschäftigten einen
Unternehmen mit großer Anzahl von Betriebsstätten oder Kraftfahrzeugen nicht gleichheitswidrig benachteiligt
Die Beitragsbemessung führt nicht zu einer gleichheitswidrigen Benachteiligung von Unternehmen mit einer strukturbedingt großen Anzahl von Betriebsstätten oder Kraftfahrzeugen, etwa von großen Handelsfilialisten oder Autovermietungen. Solche Unternehmen haben zwar aufgrund der Kombination von Betriebsstättenbezug und degressiver Staffelung nach der Beschäftigtenzahl in der einzelnen Betriebsstätte höhere Beiträge zu entrichten als Unternehmen mit derselben Mitarbeiterzahl, aber weniger Betriebsstätten und Kraftfahrzeugen. Das ist als Konsequenz der sachgerechten Typisierung vornehmlich nach Raumeinheiten hinzunehmen. Im Übrigen wird im unternehmerischen Bereich die mit der Unternehmensgröße zunehmende Spreizung der Belastungen dadurch beschränkt, dass § 5 Abs. 2 Satz 2 RBStV für jede beitragspflichtige Betriebsstätte des Inhabers jeweils ein Kraftfahrzeug von der Beitragspflicht ausnimmt. Auch wenn sich für Großunternehmen eine Zahlungspflicht in durchaus beachtlicher Höhe ergeben kann, begründet das für sich keinen Verfassungsverstoß, sondern entspricht dem Gebot des Art. 118 Abs. 1 BV, die Belastungen in einer den jeweiligen Vorteil möglichst gleichmäßig abbildenden Weise unter den Beitragspflichtigen zu verteilen.
Informationspflicht der Beitragsschuldner verfassungsgemäß
Die Pflicht der Beitragsschuldner, das Innehaben einer Wohnung, einer Betriebsstätte oder eines beitragspflichtigen Kraftfahrzeugs und die weiteren, im Einzelnen bezeichneten Informationen unverzüglich schriftlich der zuständigen Landesrundfunkanstalt mitzuteilen und auf Verlangen nachzuweisen (§ 8 i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 3 RBStV), ist
Sorgsamer Umgang mit Daten
Die wenigen anzuzeigenden Daten unterliegen zudem einer strikten Bindung an den Zweck der Erhebung des Rundfunkbeitrags. Diese strikte Zweckbindung wird flankiert durch das Gebot des § 11 Abs. 5 Satz 2 RBStV, die erhobenen Daten unverzüglich zu löschen, wenn feststeht, dass sie nicht mehr benötigt werden oder eine Beitragspflicht dem Grunde nach nicht besteht. Unabhängig davon sind nicht überprüfte Daten gemäß § 11 Abs. 5 Satz 3 RBStV spätestens nach zwölf Monaten zu löschen.
Landesrundfunkanstalt hat Anspruch auf Auskunftserteilung über Inhaber der Wohnung oder der Betriebsstätte
Das Auskunftsrecht der Landesrundfunkanstalt gegenüber Dritten nach § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 i. V. m. § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 RBStV ist ebenfalls mit der Bayerischen Verfassung vereinbar. Die Vorschriften verpflichten für den Fall, dass die zuständige Landesrundfunkanstalt den Inhaber einer Wohnung oder einer Betriebsstätte nicht feststellen kann, den Eigentümer oder den vergleichbar dinglich Berechtigten der Wohnung oder des Grundstücks, auf dem sich die Betriebsstätte befindet, der Landesrundfunkanstalt Auskunft über den tatsächlichen Inhaber der Wohnung oder der Betriebsstätte zu erteilen; bei Wohnungseigentumsgemeinschaften kann die Auskunft auch vom Verwalter verlangt werden. Dieses Auskunftsrecht verletzt weder die von der Auskunft betroffenen Inhaber der Wohnung oder Betriebsstätte noch die zur Auskunft verpflichteten Dritten in ihren verfassungsmäßigen Rechten.
Einmaliger Meldedatenabgleich verfassungsgemäß
Die Vorschrift über den einmaligen Meldedatenabgleich ist
Werbung
© kostenlose-urteile.de (ra-online GmbH), Berlin 15.05.2014
Quelle: Bayerischer Verfassungsgerichtshof/ra-online
- Rundfunkbeitrag: Neuregelung der Rundfunkfinanzierung verfassungsgemäß
(Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.05.2014
[Aktenzeichen: VGH B 35/12]) - Rundfunkbeitrag: Rundfunkabgabe nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag rechtmäßig
(Verwaltungsgericht Osnabrück, Urteil vom 01.04.2014
[Aktenzeichen: 1 A 182/13]) - Klage gegen Rundfunkbeitrag erfolglos
(Verwaltungsgericht Gera, Urteil vom 19.03.2014
[Aktenzeichen: 3 K 554/13 Ge])
Jahrgang: 2014, Seite: 456 ZD 2014, 456
Urteile sind im Original meist sehr umfangreich und kompliziert formuliert. Damit sie auch für Nichtjuristen verständlich werden, fasst kostenlose-urteile.de alle Entscheidungen auf die wesentlichen Kernaussagen zusammen. Wenn Sie den vollständigen Urteilstext benötigen, können Sie diesen beim jeweiligen Gericht anfordern.
Dokument-Nr. 18219
Wenn Sie einen Link auf diese Entscheidung setzen möchten, empfehlen wir Ihnen folgende Adresse zu verwenden: https://www.kostenlose-urteile.de/Urteil18219
Bitte beachten Sie, dass im Gegensatz zum Verlinken für das Kopieren einzelner Inhalte eine explizite Genehmigung der ra-online GmbH erforderlich ist.
Senden Sie uns diese Entscheidungen doch einfach für kostenlose-urteile.de zu. Unsere Redaktion schaut gern, ob sich das Urteil für eine Veröffentlichung eignet.